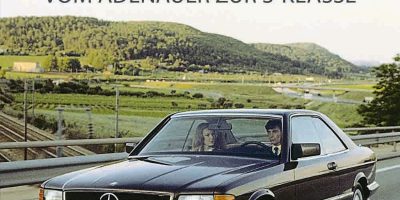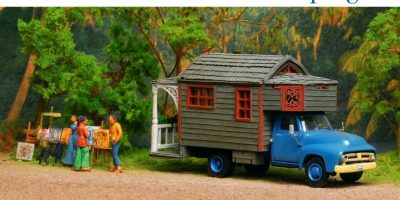Fritz, Alexander Diego: Meisterschule Kaiserslautern. Die Wiege des deutschen Karosseriebaus und das Kaiserslautern-Coupé. Wien (Verlag Brüder Hollinek) 2025. 192 Seiten. ISBN 978-3-85119-392-3. Preis 49 Euro.
Wer sich für Einzelstücke der Karosseriebaukunst, vorzüglich aus deren letzter Hochphase, der 50er Jahre, interessiert, wird angesichts des Bildmaterials aus dem Staunen nicht mehr herauskommen (sowohl Fotos als auch reproduzierte Entwurfszeichnungen). Was Alexander Diego Fritz aus den versunkenen Schatzkammern der Meisterschule Kaiserslautern geborgen hat, ist einmalig! Das sind allesamt unveröffentlichte Archivfotos erster Güte, herrliche Fahrzeuge, Realität gewordene Traumwagen ihrer Zeit. Die Karosserien der Absolventen der Meisterschule, also jedes einzelne ein Meisterstück. Nicht nur schnittige Coupés auf Käfer-Fahrgestell. Manche Studenten wählten für sich auch einen Stationswagen, wie man damals unbeholfen zum Kombi sagte, oder eine Limousine aus. Jedenfalls waren wir, selbst dem Thema Karosseriebau sehr zugetan, von diesen bislang ungesehenen Fotos in höchstem Maße begeistert! Und wir fragten uns: Warum kam noch kein anderer Automobilhistoriker auf die Idee, bei der Meisterschule Kaiserslautern anzufragen? Ja, warum kamen wir selbst nicht auf diese Idee?
Das Buch besteht nicht nur aus historischen Fotos und der Geschichte der Meisterschule. Das ist eigentlich nur Beiwerk, wenngleich herrliches Beiwerk. Den Anlass für Fritzens Buch bildet das gelbe „Kaiserslautern-Coupé“. Der Autor geht nach der „pars-pro-toto“-Methode vor und präsentiert im ersten Viertel das Meisterstück des Rudi Edinger, eines Schülers der Meisterschule Kaiserslautern in den Jahren 1966/67. Zunächst wird nicht klar, ob Fritz mit Edinger jemals sprach (er ist immerhin Jahrgang 1937 und heute somit 88 Jahre alt), aber er duzt ihn im Text und schreibt im Stile einer historischen Reportage. Sein Insider-Wissen, so mutmaßt der Leser, sollte schon auf Gesprächen basieren. So erfahren wir, dass eine Karosserie im Team erstellt wurde, die Blechmenge zugeteilt wurde, das Basisfahrzeug für die Technik (in diesem Falle ein VW Käfer) von den Studenten selbst besorgt und bezahlt werden musste. Interessant sind 13 Seiten Faksimile von Edingers schriftlicher Abschlussarbeit für die Meisterschule. 1967 hatte er den Meister in der Tasche und einen gelb lackierten Sportwagen ohne Innenausstattung und Technik vor dem Haus stehen. Er komplettierte das Auto, fuhr es einige Zeit und hob es dann auf. Logisch – sein Meisterstück verkauft man doch nicht für schnöden Mammon!
Rudis Traumwagen-Kapitel folgt das nächste über die Meisterschule Kaiserslautern, wo Stellmacher-, Wagner- und Karosseriebauhandwerk in Theorie und Praxis gelehrt wurden. Die Kaiserslauterer Lehre unterschied im Wesentlichen zwischen der Ausbildung zum Karosseriebaumeister (also dem praktischen Handwerker) und dem Karosserie- und Fahrzeugtechniker (dem Theoretiker am Zeichenbrett); Fritz geht detailliert auf die Lehrpläne ein. Wenn man heute auf seltenen Fotografien unbekannte Fahrzeuge erspäht und um deren Herkunft rätselt, so kann gut sein, dass es sich um Meisterstücke aus Kaiserslautern handelt. Denn die Fahrzeuge wurden nach Fertigstellung verkauft, wodurch die Meisterschule Einnahmen erzielte. Vor allem Angehörige der amerikanischen Besatzungsarmee waren Käufer, und der Kaiserslauterer Gebrauchtwagenhändler Benno Kleinau versorgte sie mit den Objekten der Begierde, denn er hatte gute Kontakte zur Meisterschule, die fortan zur Eigenfinanzierung Auftragsarbeiten für Kleinau ausführte, die direkt in die USA exportiert wurden.
Die Kaiserslauterer Fahrzeuge bauten fast immer auf dem Chassis des Volkswagen auf, und optisch orientierten sich die Kandidaten an ihrem Traumwagen, und das war sehr häufig der Porsche, vom 356 über den 904 Carrera GTS bis hin zum Elfer. Der Komplettwagenbau hielt sich in der Meisterschule bis zum Jahr 1970. Ein Kapitel widmet Fritz der Biographie von Direktor Wilhelm Olfermann, der die Schule von Mitte der 20er bis in die 60er Jahre hinein prägte, sowie den Bemühungen der Schule, den Kandidaten nicht nur handwerkliches Geschick beizubringen, sondern auch deren Stilgefühl zu fördern – was natürlich zweischneidig ist, denn fördern lässt sich nur, was zumindest in Anlagen vorhanden ist. Der Spagat zwischen Handwerker und Künstler ist zumindest dann in der Karosseriegestaltung offensichtlich, wenn kein Designer involviert ist. In der Meisterschule wurde auch die Formensprache benotet – aber eben von Technikern.
Das letzte Drittel widmet sich dem konkreten „Kaiserslautern-Coupé“, nach dem das Buch benannt ist, das den Titel ziert und das auch Anlass zum Verfassen war. Hier erfährt der Leser (endlich), warum er im Eingangskapitel über Rudi Edinger, den Meisterschüler von 1966/67, gelesen hat. Er lebt noch. Die Familie Edinger kontaktierte Fritz nach Lektüre seiner anderen VW-Sonderkarosserien-Bücher. Fritz bekam das Unikat und versprach, es bis zu Rudi Edingers 85stem Geburtstag zu restaurieren – was gelang. Das Restaurierungskapitel, in der Ich-Form verfasst, geht sehr launig und ausgiebig auf alle Umstände der Wiedererstehung des gelben Coupés ein. Der Leser erfährt von Chilli con Carne, Fritzens Erlebnissen mit der deutschen Umweltplakette für seinen in Österreich zugelassenen Wagen, von Mäusekot, von altem Benzin, welches das ganze Haus vollstinkt… Das ist eine Mischung aus humoristisch, peinlich, unterhaltsam und sachlich, oft sehr persönlich, für mancher Leute Geschmack zu persönlich – eben ein Restaurierungstagebuch, das über den Fortgang derselben ebenso berichtet wie über die Gemütszustände der beteiligten Personen. Man kann das so schreiben. Man muss aber nicht. Der Leser muss das Restaurierungstagesbuch nicht mal lesen und hat dennoch den Eindruck, für sein Geld etwas sehr Wertvolles bekommen zu haben. Die ersten zwei Drittel des Buches sind die 49 Euro bei weitem wert! Wir sind nach wie vor vom Bildmaterial und der Erkenntnis über die Meisterschule Kaiserslautern beeindruckt.
Diese ersten beiden Drittel sind auch ganz anders geschrieben als das Tagebuch, sachlich eben, den Regeln des Chronisten entsprechend. Fritz schreibt in einem ziemlich unprätentiösen, teilweise fast schon einfachen Stil. Nett für den deutschen Leser sind die Austriazismen wie „Wägen“ als Plural von „Wagen“ oder „Jänner“ für Januar“. Ein paar mehr Kommas (die in Österreich „Beistrich“ heißen) und Bindestriche wünscht sich der Leser, aber vielleicht ist das auch nur österreichische Orthographie – was wir nicht negativ verstanden wissen wollen. In Österreich und in der Schweiz gibt es tatsächlich einige Sprachregelungen des Deutschen, die vom deutschen Deutsch abweichen, so gelehrt werden und somit dort richtig sind. Wer’s nicht glaubt, kaufe am Bahnhof und lese ein Exemplar der Kronen Zeitung, die sich ohne Bindestrich schreibt.
Nach wie vor ein Ärgernis an Fritzens Büchern ist der unstillbare Drang des Autors zur Selbstinszenierung – was uns schon bei seinen früheren Werken unangenehm auffiel und was wir damals genüsslich kommentierten. Aber Fritz hört nicht auf uns! Im aktuellen Buch zählen wir 15 Aufnahmen, worauf der Herr Fritz mit Zopf dem Leser entgegenblickt, und der Gipfel ist jene auf Seite 184, worauf er eine Schweinshaxe verspeist. Das erinnert schon fast an den Hashtag „#Söder isst“ und hat in einem automobilhistorischen Buch, so gut es uns auch gefällt, nichts verloren. Fazit: Wir wollen weitere Bücher von Alexander Diego Fritz lesen, aber wir wollen Alexander Diego Fritz nicht mehr so oft anschauen müssen – weder grinsend noch schraubend noch essend.
afs